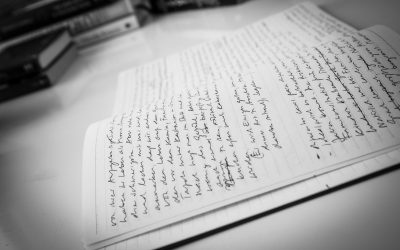Comtesse de Sévigné auf Abwegen
Über unserem Wohnzimmer, dem ausufernden Bücherregal, stand ein Sekretär randvoll mit Papieren. Die vielen Schubladen des Sekretärs waren geschlossen, doch drehte Madame Lantzman, unsere Nachbarin, den Schlüssel in einer von ihnen um und zog sie heraus, blickte einem ein Zettelmeer aus Hoffnungslosigkeit entgegen.
Ich hörte ihre Schritte, nachts knarrte der Dielenboden im Schlafzimmer, tagsüber im Wohnzimmer, im Spätsommer hörte man Geschirrklappern durch das offene Küchenfenster, wenn Catherine, wie sie uns nach zweijähriger Nachbarschaft bat, sie zu nennen, sich eine ihrer sporadischen Mahlzeiten aus gekochtem Schinken und hartem Ei bereitete. Über meinem Arbeitszimmer hörte ich sie nie gehen, denn gehen konnte man in dem bis auf eine schmale Passage zum Fenster mit der Zwergzeder vollgestellten Raum nicht, der früher einmal Kinderzimmer gewesen war und den sie seit Jahren ausräumen und als Gästezimmer herrichten wollte, in jeder ihrer fieberhaft aktiven Phasen zumindest. Unmöglich, sich auch nur umzudrehen zwischen den alten Matratzen, Kommoden, Bücherkisten, Kartons voller Kinderspielzeugen und Gläsersortimenten, Bettüberzügen, Lampenständern und Tüten mit erhaltenen oder nicht gemachten Geschenken. Die Zwergzeder, die wir von unserem Badezimmer aus über den winzigen Innenhof sahen, um den unsere Wohnungen rückwärtig ausgerichtet waren, ihre im dritten, unsere im zweiten Stock, goss Catherine täglich, bis es metallen auf mein Fensterbrett tropfte. Das Bäumchen sei ihr Süden, sagte sie.
Abgestaubt wurde Catherines Gerümpelraum von einer dreimal wöchentlich kommenden jungen Frau aus Mauritius, die man nicht eigentlich als Putzfrau bezeichnen konnte, fungierte sie auch als solche, dem Staubsauger nach zu urteilen, den man jedes Mal frenetisch lange durch die hellhörigen Decken des alten Gebäudes dröhnen hörte.
Zwei Anläufe des Aussortierens habe ich mit Catherine unternommen, doch blieb es bei geringfügigen Platzverschiebungen. Stundenlang haben wir Schicht für Schicht abgetragen und neue Kartons angelegt, unterteilt in Fortzugebendes, vornehmlich an die beiden erwachsenen Kinder und die Enkelkinder, Aufzuhebendes und Wegzuwerfendes, letzteres immer ein verzweifelnd kleiner Teil, den ich so rasch wie möglich außer Reichweite vor die Wohnungstür brachte, bevor sie es sich anders überlegte. Das Aufzuhebende haben wir in das ehemalige Mädchenzimmer geschafft, das neben dem unseren in einem vom Treppenhaus abgehenden Korridor lag, und zu den dort im Dunkeln hindämmernden anderen Kisten, Stühlen und Kommoden verfrachtet; ohne noch zu überlegen habe ich es hingestellt, wo gerade noch Platz war, auf einen Sessel, einen Bücherstapel oder direkt auf den modrigen Steinboden, und die Tür hinter mir zugezogen in dem dünngelben, fast gaslampenartigen Schein des Mädchenzimmerflurs, wo Catherine stand, um den Schalter zu drücken, wenn das Licht ausging. Etwa zwei Quadratmeter Zimmer hatten wir am Ende des Nachmittags frei geräumt, ganz glücklich war sie darüber, dass man wieder bis zum Fenster gelangen und es öffnen konnte. Bereits am nächsten Tag hat sie den Blumenkasten mit dem Vorgänger der diesjährigen Zwergzeder angebracht.
Im Anschaffen von Dingen war sie in diesen ersten Tagen des Erwachens, wie sie ihre aktiven Phasen nannte, überaus eifrig. Neben den Pflanzen, die immer ein gutes Zeichen waren, hat sie über die Jahre hinweg etliche Aquarelle gekauft, die ihre Kinder scheußlich fanden, wie sie uns gestand, worüber wir ihr halbherzig hinweghalfen, Porzellanschälchen für Marmelade, von denen sie uns eines schenkte, ein Gitterbettchen für das letzte Enkelkind, das im Esszimmer noch bereitstand, als besagtes Kind bereits an die fünf Jahre war, neben den Tüten namhafter Geschäfte, die ebenfalls an der Esszimmerwand gestrandet waren. Einen Orientteppich hat sie einmal gekauft von einem Händler, der eines Tages an der Concierge vorbei bis in den dritten Stock hinaufgelangt war, als hätte eine bewundernswerte Intuition ihm eingeflüstert, es sei der richtige Augenblick, in diesem Viertel, das längst keine fliegenden Händler mehr kannte, ein erfolgreiches Geschäft abzuschließen. Einmal ließ sie die Küche völlig ausräumen und neu streichen, über zwei Wochen war der Inhalt aller Wandschränke auf dem Wohnzimmerparkett verteilt, wobei sie erstaunt das vollständige Junggesellenservice ihres vor über dreißig Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommenen Mannes entdeckte. Als wir ihr vom Markt Weintrauben und Fisch brachten, zeigte sie uns amüsiert ihren Basar, wie sie es nannte, forderte uns auch auf, uns von einem gesonderten Stapel blinder Glasschälchen und angeschlagener Tassen zu bedienen, und stellte uns den Anstreicher vor, einen gutmütig aussehenden Schwarzen, den ein Cousin ihr empfohlen hatte.
Einen Koran habe er ihr geschenkt, berichtete sie zwei Tage später beglückt über die Freundlichkeit des Malers, der viel über gegenseitigen Respekt und Verständnis spreche, und wie er zu einem würdigen Leben gefunden habe und welchen Halt die Religion den Menschen gebe. Sie höre ihm gern zu, sagte sie, nur komme es ihr langsam etwas seltsam vor, zweimal habe er sie nun schon gefragt, ob sie mit der Lektüre des Korans begonnen habe. Das habe sie natürlich nicht vor, auch die Moschee gedenke sie nicht zu besichtigen, deren Adresse er ihr gegeben habe, und schließlich war sie nur noch froh, als die Küche fertig gestrichen war. Das Geschirr blieb noch eine Weile im Wohnzimmer, gerade noch rechtzeitig vor dem nächsten Zusammenbruch räumte sie es mit der Mauritierin wieder ein, trug ihr die ein oder andere Schale nach, womöglich auch das Junggesellenservice, das ihr Sohn, dem sie es zugedacht hatte, nicht wollte, oder die Schwiegertochter nicht wollte, der man nie etwas recht machen könne.
Dann verschloss sich ihr Gesicht, ihre Sätze am Telefon wurden knapp, sie nahm das Obst vom Markt misstrauisch entgegen, zählte Münzen aus einem ledernen Portemonnaie in unsere Hand. Ihre Mundwinkel sackten beim Sprechen ab, und irgendwann wurde deutlich, dass oben die Lähmung eingezogen war; dass auch dieses Mal die Fenster keine neuen Vorhänge bekommen würden, die alten weiter sonnengebleicht und spröde, tatsächlich fast in Fetzen über die Raffer fallen würden, und die sich neben ihrem Bett stapelnden Bücher in keine neuen Regale geräumt werden würden, dass auch der geplante Umzug der Waschmaschine in die Küche, zur Wiederinbetriebnahme des von Wäsche überquellenden Gästebads neben dem Abstellzimmer würde warten müssen. Spätnachts hörte ich ihre Schritte in dem Schlafzimmer über unserem Schlafzimmer auf dem Parkettboden knarren, und hinter unseren Vorhängen körnte der Lichtschein aus ihrem Fenster in die Nacht. Morgens blieben die Läden vor ihrem Schlafzimmer lange geschlossen, bis in den Nachmittag hinein.
Normalerweise kam irgendwann immer wieder ein Telefonanruf von oben, mit der Bitte, ob wir ihr helfen könnten, einen bestimmten Fernsehsender in der langen Reihe der ihr von der Kabelgesellschaft mangels Widerspruch frei geschalteten Kanäle zu finden, was auf einen neuen Anlauf hindeutete, die Medikamente zu bekämpfen. Dieses, die Medikamente abzusetzen, war erklärtes Ziel jedes ihrer Erwachen, worin wir sie gern bestärkt hätten, wären wir nicht mit jedem neuen Einbruch etwas unsicherer ob der tatsächlichen Bestimmung besagter, stets namenloser Medikamente geworden. Also rieten wir ihr ab, ohne das Wissen ihres Arztes oder ihrer Kinder radikale Maßnahmen zu ergreifen, zu denen sie gerade in diesem Sommer, in den letzten Wochen, entschlossen schien.
Während der letzten schlechten Phase hatte ihre Schwiegertochter sie in das für den Sommer bei Bordeaux gemietete Ferienhaus eingeladen. Sie überließ Catherine dort offenbar weitgehend sich selbst, während sie selbst den Tag mit den Kindern am Strand verbrachte, ohne auch nur etwas zum Essen vorzusehen, doch so habe sie einige längst überfällige Kilo verloren, so Catherine später zu uns. Danach fühlte sie sich, trotz allem, wieder blendend, voller Unternehmungslust für den nächsten Urlaub kurz darauf mit ihrer Tochter, Höhepunkt der diesjährigen Euphorie.
Lange habe sie sich nicht so voller Energie gefühlt, sagte sie bei ihrer Rückkehr, das Land sei es gewesen, die frische Luft und die Blumen, ein Haus würde sie kaufen, habe sie beschlossen; nicht weit von dem Ferienhaus, das ihre Tochter gemietet hatte, sei eines zum Verkauf angeboten, es habe ihrer Tochter zwar nicht gefallen, aber schließlich sei es ja für sie, sie denke nicht mehr daran, sich nach allen anderen zu richten, herrlich würde sie es dort haben, inmitten der Natur, ein Haus, wo sie ihre Kinder und Enkelkinder und Freunde würde empfangen können. Die deutsche Frau ihres Cousins erwähnte sie dabei wieder, mit der sie mich seit drei Jahren mittels eines Abendessens bekannt machen wollte. Einladungen zum Mittag- oder Abendessen auszusprechen gehörte auch immer zu den großen Projekten, eines hatte sie in den letzten Jahren zustande gebracht, die Gerichte hatte sie von einem nahe gelegenen winzigen Restaurant mit einer griesgrämigen, von ihr jedoch hoch gelobten alten Besitzerin liefern lassen.
In diesem Haus auf dem Land also würde sie das alles verwirklichen können, eine andere Möglichkeit gäbe es da allerdings noch, ein junges Mädchen, das sie bei der Rückfahrt im Zug kennengelernt und mit der sie sich äußerst angeregt die ganze Zeit über unterhalten habe, darüber müsse sie beim Aussteigen wohl auch ihre Tasche mit dem Hausschlüssel im Abteil vergessen haben, habe ihr erzählt, ihre Eltern vermieteten eine Wohnung in ihrem Haus bei Uzès, eine wundervolle Gegend, in der sie Bekannte habe. Und ein italienisches Ehepaar, die ein Stück weit mit ihr gefahren seien, habe sie nach Italien eingeladen, nach Umbrien, wenn sie sich recht entsinne, und dorthin würde sie auf jeden Fall reisen, vielleicht schon nächste Woche, ganz reizend seien sie gewesen.
All das berichtet sie uns am Abend ihrer Ankunft vor wenigen Wochen, als sie wegen des nicht auffindbaren Täschchens und Hausschlüssels bei uns geklingelt hatte. Sie verstehe nicht, wie ihr das habe passieren können, in dem Täschchen hätten sich auch die Adressen des jungen Mädchens und des italienischen Ehepaars befunden, sagte sie, während wir den in der Kommode vor ihrer Haustür versteckten Schlüssel zu ihrem Mädchenzimmer suchten, der zu unserer Erleichterung auftauchte, wie auch im Mädchenzimmer der Ersatzhausschlüssel, den sie im Waschbecken unter einigen im Dunkeln undefinierbaren Objekten ertastete. Von unten brachten wir ihr die Zwergzeder und die Geranienstummel hoch, und sie erzählte von den Blumen, die sie im Garten gepflückt habe, von den großzügigen Eigentümern des gemieteten Hauses, die ihnen alle Freiheiten gelassen hätten, und den Sträußen, die sie gebunden habe, einmal habe ihr Schwiegersohn sogar bemerkt, sie habe einen exquisiten Geschmack. Einen exquisiten Geschmack! Jahrelang habe sie kein Vertrauen in ihren Geschmack gehabt, schon ihre Mutter habe immer gesagt, sie habe keinen, aber das sei ihr jetzt egal, auch gemalt habe sie dort, kleine Aquarelle, sie wollte mir eines zeigen, doch ließ sich der Koffer nicht öffnen. Sie habe sich fest vorgenommen, damit weiterzumachen, für den Zeichenkurs am Louvre würde sie sich einschreiben, wie sie es schon nach der Schule habe tun wollen, was ihre Eltern nicht zugelassen hätten, auch Louis, ihr Mann, habe sie darin bestärkt, doch da waren die Kinder noch klein, und dann kam der Unfall. Jetzt aber würde sie endlich ihr Leben in die Hand nehmen. Sie nahm eine kleine Flasche Vittel vom Tisch und trank daraus.
»Aus der Flasche!« rief sie aus. »Hätte meine Mutter das gesehen!«
Ihre vierundneunzigjährige Mutter führte ein strenges Regiment über die sich schichtweise ablösenden Dienstboten in dem großen Familienhaus bei Tours. Catherines Vater hatte dort eine Papierfabrik mit über fünfhundert Angestellten besessen. Sah der Vater einen seiner Arbeiter auf der anderen Straßenseite, ging er zu ihm hinüber, um ihn mit Handschlag zu begrüßen und nach der Familie zu fragen. Zu Hause wurde sparsam mit Papier umgegangen, nur in Sonderfällen bekamen die neun Kinder ein Blatt zugeteilt. In der Bibliothek mit den steifen braunen Buchrücken standen in den obersten, unerreichbaren Reihen die Lexika, den Kindern verboten, weil sie »gewisse Dinge« enthielten. Erlaubte Bücher handelten von Napoleon oder Jeanne d’Arc oder stammten von der Comtesse de Sévigné. Catherines Mutter lebte in unentwegter Angst, ihre Töchter könnten schwanger werden. Einmal bekam Catherine starke Bauchschmerzen, wie eben »an diesen Tagen«, und legte sich zu Bett. Die Mutter kam herbeigestürzt. »Du wirst doch nicht etwa schwanger sein?«
Das habe sie gekränkt, sagte die heutige Catherine. »Wir wollten doch rein bleiben. Es war alles, war wir hatten.«
Sonntags fuhren Vater und Kinder mit dem Fahrrad zur Messe. Während des Krieges hatte er als Fabrikbesitzer das Recht auf Benzinzuteilungen, doch um mit gutem Beispiel voranzugehen, bewegte er sich nur auf dem Fahrrad fort. Sehr viel später hatte Catherine erfahren, dass zwischen Vater und Mutter eine Abmachung herrschte, nach der die Mutter sich um die Mädchen, der Vater sich um die Jungen kümmerte. Sehr schade sei das gewesen, sagte Catherine.
Mit der ihr nächsten Schwester hatte sie im gemeinsamen Zimmer ein Spiel erfunden, wenn sie nicht einschlafen konnten. Die eine wisperte der anderen quer durch den Raum zu: »Schläfst du?« »Nein, sagte die andere, was machen wir?« »Spielen wir kleine arme Waisen.«
Und gegenseitig schilderten sie sich, wie sie sich im dunklen Wald verloren hatten, bis sie ein Licht aufflackern sahen, eine Tür, die sich öffnete, und dahinter war es warm und hell, und eine Stimme sagte: Tretet ein, meine Kinder. Und in der durchdringenden Dunkelheit des Zimmers hätten sie dieses Licht tatsächlich gesehen, sagte Catherine.
Wir saßen auf ihrem Sofa. Ihre Wohnung war die oberste des dreistöckigen Gebäudes aus dem 18. Jahrhundert, das früher einmal Quartier für die Stallmeister des gegenüberliegenden Palais gewesen war. Durch die Fenster happte das Tageslicht an Vorhängen und dem gelben Sofa, das richtig gelb nur noch hinter den Sitzkissen war. Auf einem Plexiglastablett standen Gläser und eine Flasche Martini, »das haben wir früher immer getrunken, zum Aperitif, neulich habe ich eine Anzeige dafür gesehen und mir gesagt, das musst du einmal wieder kaufen. Kennen Sie Martini? Und möchten Sie vielleicht eine Craven dazu?, das waren immer die elegantesten Zigaretten, eine Craven aus einer silbernen Zigarettendose angeboten zu bekommen, war sagenhaft stilvoll. Ich werde so eine Zigarettendose besorgen. Eigentlich sollte man immer Zigaretten zu Hause haben, um Gästen welche anzubieten.«
Umständlich zündete sie sich ihre Zigarette an, und wir pafften beide in die verblichene Nachmittagsluft des Wohnzimmers. Auf einem Stapel mit Figaro-Magazinen lagen neueste Zeichnungen ihres Enkels Louis.
Auch die Zwillinge ihrer Tochter begännen schon zu laufen, »zu schade, dass sie so weit weg wohnen, in Montmartre, am anderen Ende von Paris, da sind sie nicht wegzubekommen, es ist ja auch ein reizendes Viertel, nur etwas unpraktisch«. Trotz meiner Fingerzeige fiel die Asche von ihrer Zigarette auf den Stoffbezug des Sessels. Der Aschenbecher stand auf ihrer Seite des Tisches, doch als ich Anstalten machte, aufzustehen, um ihn in die Mitte zu schieben, unterbrach sie sich und reichte ihn mir, die Zigarette vergessen zwischen den Fingern.
Sah man Catherine auf der Straße, ohne von ihr gesehen zu werden, war ihr Gesicht wie entwohnt. Und sie konnte vorübergehen, sich an Papiertüten oder ihrer Handtasche einhaltend, ohne den Blick zu heben, bis man mit einem lauten »Bonjour Catherine« eine Gegenwart in ihren Blick scheuchte. Nach einem Augenblick fand ihr Mund ein Lächeln aus dem Niemandsland, in dem sie gerade noch gewandert war, und erzählte drauflos von den Geschäften, in denen sie dies oder jenes gefunden hatte. Blieb der Mund ein wenig schief und wortkarg, war es kein guter Tag.
An einem solcher Tage hatte eine alte Freundin einen Selbstmordversuch begangen, den dritten in wenigen Wochen. Ich war ihr einmal begegnet, einer Frau mit strengen Zügen und eiserner Disziplin, die Catherine in regelmäßigen Abständen dazu brachte, Dinge zu unternehmen. Offenbar hatte sie von ihrer Tochter zu hören bekommen, länger als zwei Wochen dürfe man sich niemandem als Besuch zumuten. Der Taxifahrer hatte Catherine zugestimmt, dass dieser Satz der Auslöser für die versuchte Selbstauslöschung gewesen sein musste.
Catherine hatte sich dem Tod ihres Mannes vier Jahre lang aufrecht gehalten. Sie machte mit den beiden Kindern Spaziergänge zu den Rasenflächen hinter dem Invalidendom, sogar bis zum Grand Palais und den Tuillerien. Dann konnte ihr sechsjähriger Sohn von einem Tag auf den anderen drei Finger nicht mehr bewegen. Der aufgesuchte Arzt schloss vom Tod des Vaters – »aber er starb bei einem Autounfall, Herr Doktor« – und der steifen rechten Hand des Großvaters – »aber er wurde von einer Granate verletzt, Herr Doktor« – auf den Beginn einer vererbten Lähmung. Am Boden zerstört konnte Catherine auch dem daraufhin einberufenen Komitee von Spezialisten keinen Glauben mehr schenken, das sie vergeblich zu überzeugen versuchte, wie fahrlässig diese erste Diagnose gewesen sei. Man verschrieb ihr Medikamente gegen die Depression.
Die darauffolgenden Jahre verlebte sie in einem dahindämmernden Bewusstseinszustand, der sich für Momente lichtete, gerade so lange, dass sie sich etwa entsann, wie ihr Vater sie bei einem längeren Besuch im Hause der Eltern zu einem nicht genau zu bestimmenden Zeitpunkt in eine psychiatrische Klinik hatte zwangseinweisen lassen, als sie bei einem Mittagessen nicht pünktlich bei Tisch erschienen war und sich auf seine Rüge hin wieder erhoben hatte. Vor den Augen ihrer Kinder habe er ihr ungeachtet allen Widerstands von einem Pfleger eine Spritze geben und sie fortbringen lassen. Mehrere Monate habe sie in der Klinik zugebracht, die beiden Kinder bei jeweils einem ihrer Brüder untergebracht. Wären die Kinder nicht gewesen, inzwischen selbst schon Eltern, nichts hätte erkennen lassen, dass diese Begebenheiten sich vor über dreißig Jahren abgespielt hatten, so wie auch die konfliktreiche Beziehung zu ihrer Mutter dem Wandel der Zeit beharrlich trotzte. Nach jedem Besuch in Tours empörte Catherine sich über Ungeduld, Herrschsucht und unaufhörliche Kritik der alten Dame. Zwei intelligente Kinder habe sie, habe die Mutter einmal gesagt, und von den neun Geschwistern ohne mit der Wimper zu zucken eine Schwester und einen Bruder genannt, so erzählte Catherine es uns, und das sei doch allerhand gewesen. Vielleicht war ihr auch deshalb untersagt worden, nach der Schule ein Philosophiestudium zu beginnen, wie es ihr Wunsch gewesen wäre. Philosophie untergrabe den Glauben, habe die offizielle Begründung allerdings gelautet, und auch ein Zeichenstudium war für unpassend befunden worden. Den Glauben hatte sie dann ganz von alleine verloren, in keine Messe habe sie nach Jean-Louis’ Unfall mehr gehen können, sagte sie, wie solle man schon an einen Gott glauben, der so etwas zulasse.
Mit Jean-Louis hatte sie Tennis gespielt und im Gras gesessen, vor ihrer Heirat war das gewesen. Jean-Louis sei israelitischer Konfession gewesen, erwähnte sie so behutsam, wie solche Dinge wohl auszusprechen gewesen waren. Jüdisch sage man ja nicht, und genauer habe sie sich auch nie damit befasst, jedenfalls habe sie daran aber nichts Schlimmes finden können. Mit Jean-Louis war sie im Auto bis nach Südfrankreich gefahren und hatte diese Wohnung im siebten Pariser Arrondissement bezogen. Den mittlerweile vergilbten Wandteppich hatte er ausgesucht, ebenso das Dienstmädchen, das ihr zur Hand gehen sollte, von dessen Allgegenwart in der Etagenwohnung sie sich aber verfolgt fühlte.
Die Umgestaltung von Jean-Louis’ Grab auf dem Friedhof in der Nähe ihres Elternhauses war ein weiteres, neu aufgegriffenes Projekt. Einen scheußlichen schwarzen Marmorstein habe ihr Vater darauf errichten lassen, düster und kalt, den würde sie abreißen lassen, der Vater war nun schon lange tot, und durch einen freundlichen, hellen Stein ersetzen, und Blumen würde sie pflanzen, viele Blumen, und eine kleine Baumgruppe darum, das war auf dem Friedhof zwar nicht üblich, doch würde sie eine Genehmigung erbitten.
Zurück in eine Kirche hatte sie erst das farbige Kindermädchen der Zwillinge ihrer Tochter gebracht, eine imposanten Matrone, mit der sie an den Nachmittagen im Süden Gespräche über Gott und die Welt geführt und deren unerschütterlicher Glauben nachhaltigen Eindruck in ihr hinterlassen hatte, wie auch die ebenso pragmatisch wie beiläufig erwähnte Tatsache, dass Maria natürlich keine Jungfrau gewesen sein konnte. Catherine besuchte nach dreißig Jahren zum ersten Mal wieder den Invalidendom. Besonders gerührt wurde sie dabei von einer Gruppe echter Invaliden, die in Rollwagen, wie sie sich ausdrückte, so dass man unwillkürlich an Kriegsmodelle mit ausgefahrenen Beinvorrichtungen dachte, zum Gottesdienst gefahren wurden und ein höchst bedauerliches Bild abgegeben hätten, das sie in ihrer eigenen wiedergefundenen Gesundheit noch seliger zu machen schien.
Nach dem Gottesdienst hatte sie sich die Kaprize eines Frühstücks in einem neuen, sehr schicken Café an der Invaliden-Esplanade erlaubt und dort ein australisches Ehepaar kennengelernt. Sie hatten sie nach Australien eingeladen, und Catherine war ganz hingerissen über das Netzwerk, das sie sich über die ganze Welt einrichten wollte, man könne sich gegenseitig besuchen und das jeweilige Land zeigen, ein Foto hatte sie von ihnen gemacht mit der Wegwerf-Kamera, die sie nun überall mitnahm.
Als ich vor demselben Café auf sie wartete, um das dort so köstliche Frühstück zu kosten, machte ich sie an dem kleinen Gärtchen an der Rückseite der Kaserne aus, wo sie die gerade besprengten, im Halbschatten glitzernden Blumenbeete durch das Gitter fotografierte, sich dann umdrehte und den mit einer Hand vor ihr Gesicht gehaltenen Apparat auf das gegenüberliegende Metroschild richtete, bis ich sie erreicht hatte und mich selbst vor einem Baum in Pose stellen musste.
Wir setzten uns an einen der auf dem Gehsteig gereihten Tische in die Sonne, sie setzte eine verbogene Brille mit dunklen Gläsern auf und wir bestellten Kaffee bei einem jungen Mädchen, das ungerührt ob Catherines familiärer Begrüßung ein Körbchen Croissants hinstellte, elegant auf weißen Servietten präsentiert. Dazu ein Glas frischer Pampelmusensaft, sie habe gerade gelernt, wie gesund das sei, mit etwas zittriger Hand führte sie ihn zum Mund, an dem noch ein Blätterteigfetzen hing. Sie habe vergessen, Geld abzuheben, aber natürlich sei es eine Einladung, am Vortag bereits hätte sie eigentlich auf die Bank gemusst, da habe sie beim Abholen ihres nachgemachten Hausschlüssels festgestellt, dass das Portemonnaie leer war. Aber wie unfreundlich die Leute auch manchmal seien, beim Schlüsseldienst habe man ihr in Ermangelung der Bezahlung doch tatsächlich das Original nicht mitgeben wollen, nur die beiden Kopien, es sei wirklich zu dreist, einfach so ihren Hausschlüssel behalten zu wollen, und das habe sie dem übellaunigen Individuum auch gesagt, das sie bedient habe, sie würde sich nicht mehr alles gefallen lassen, das stehe fest. Lange genug habe sie sich von anderen dreinreden lassen, jetzt würde sie nur noch tun und lassen, wonach ihr der Sinn stehe. Alle ihre Aquarellbilder aufhängen zum Beispiel, auch wenn sie ihren Kindern nicht gefielen, schließlich habe ihr Schwiegersohn gesagt, sie habe Geschmack, man dürfe sich nicht abbringen lassen.
Wir gingen am Invalidendom vorbei zurück nach Hause, sie fotografierte die goldene Kuppel durch die schwarzen Gitterstäbe und ein kleines Hündchen, das an der Leine vorbeigeführt wurde, und sagte, wie leid es ihr tue, dass ich noch nicht ihre deutsche Schwägerin kennengelernt habe, aber einem befreundeten Ehepaar habe sie nun endlich die lange ausstehende Gegeneinladung gemacht, oft sei sie früher ins Konzert mit ihnen gegangen, und danach habe es ein zwangloses Abendessen bei ihnen zu Hause gegeben, genauso würde sie es machen, etwas Wein und Käse und Schokoladenkuchen. Das Kindermädchen ihrer Tochter werde kommen, um ihn zuzubereiten, ihre Enkelkinder hätten sich im Urlaub darauf gestürzt, und sie habe festgestellt, wie gut ihr Schokolade täte, viel Schokolade esse sie nun, das beruhige. Überhaupt achte sie jetzt auf ihre Ernährung, sie habe nicht regelmäßig genug gegessen, das sei es gewesen, aber jetzt würde alles anders. Sie würde ein Abendessen geben, und dann einen Brunch für die Kinder, ohne Rücksicht auf ihre kritische Schwiegertochter, die bestimmt eine Bemerkung machen würde, wenn das Alltagsbesteck gedeckt wäre, nicht das gute silberne, das sonst erst geputzt werden müsste. Doch galt es ja zunächst, Ordnung zu schaffen, sie habe so viel nachzuholen, aber sie sehe jetzt alles ganz klar. Zwanzig Jahre habe sie aufzuholen, doch wenn die Wohnung einmal darauf ausgerichtet sei, Besuch zu empfangen, würde alles anders. Auch das ehemalige Kinderzimmer, dessen von mir einmal freigeschaufelter Durchgang zum Fenster über die Jahre einigermaßen hatte bewahrt werden können, wollte sie endlich in ein Fremdenzimmer umwandeln, dann könne auch einmal jemand bei ihr übernachten, das wäre ein Spaß. »Ich fange an zu leben«, sagte Catherine, »und da gibt es so viel zu tun.«
Ging ich zu ihr hinauf, waren die Papiertüten im Esszimmer mal an der einen Wand, mal an der anderen Wand zusammengestellt, schlingerndem Treibgut gleich. Das Gitterbett, das an der Längsseite gegen den Esstisch drängte, sei zwar zu nichts mehr nütze, aber so hübsch anzusehen mit seinen weißen Streben und dem himmelblauen Federbett. »Überhaupt, sie sollen sich nicht so anstellen, auch das habe ich gelernt, ich sage, was ich denke. Ich lasse mir nicht mehr alles gefallen, ich bin nicht mehr immer die nette Catherine, mit der man alles machen kann. Und sehen Sie nur, heute hat das Mädchen diese ganzen Sachen abgestaubt und sortiert, Silbersachen hier, Glas da, Papiere dort, und alles Elektrische in einen Karton. Ich wusste gar nicht, dass ich so viele Glühbirnen habe.«
Sie kicherte und zuckte dabei mit den Schultern und hatte ein befreites Gesicht wie lange nicht, der rostrote Lippenstift sorgfältig nachgezogen, und wollte mich mitnehmen, mir eine Boutique zeigen, ganz in der Nähe, wo es wirklich ganz hinreißende Pullover und Kaschmirwesten gebe, auch Paschminas, von denen man ja nie genug haben könne, wie ihre Schwiegertochter einmal gesagt habe, denn das müsse man ihrer Schwiegertochter lassen, Geschmack habe sie. Nur dass sie sie neulich, als sie ihnen einen Besuch abgestattet hatte, mit den beiden Kindern in den Park geschickt hatte, obwohl es bereits nach Regen ausgesehen habe, sei nicht in Ordnung gewesen. Und auch nicht, dass sie dann mit ihren Enkeln unten in der Halle habe warten müssen, bis die Schwiegertochter vom Einkaufen zurück gekommen sei.
»Das tut man nicht, nicht wahr?, aber das habe ich Jean auch gesagt, deine Frau verhält sich mir gegenüber nicht korrekt, habe ich gesagt, nur kommt er ja so selten allein, so selten kann man überhaupt noch mit ihm sprechen. Er arbeitet zuviel, und dann ist es rührend, wie er mit den Kindern Hausaufgaben macht, wo soll er da noch die Zeit hernehmen, natürlich, und ich habe ja so ein Glück mit meinen Kindern. Und dann heißt meine Schwiegertochter auch noch Catherine, wie ich, ist das nicht komisch? Einmal haben wir mit ihrer Familie zu Abend gegessen, da waren die beiden noch nicht verlobt. Und denken Sie nur, während des Essens sagt doch Catherines Vater quer über den Tisch: ›Unsere Kinder kennen sich ja nun schon eine Weile, meinen Sie nicht, Ihr Sohn sollte langsam seine Absichten konkretisieren?‹ Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte, so etwas tut man doch nicht, oder?, ich war ganz verwirrt. In solchen Momenten hat mir Jean-Louis immer so sehr gefehlt, es ist eben etwas anderes, wenn man ganz allein auftritt.«
Ein paar Tage später kam das Kindermädchen Marie, und die Vorbereitungen begannen, ich wurde telefonisch um eine Kuchenform gebeten und um einen Mixer; als ich damit hinaufging, thronte die schwarze Nanny auf einem Stuhl im Esszimmer zwischen den Tüten und Schachteln und dem Kinderbett und lächelte gelassen. Vierundzwanzig Stunden später wurde es dann ernst, das Klappern der Töpfe und Rücken der Stühle war durch die Zimmerdecke zu hören, ein Notanruf erreichte mich, weil man Schnittlauch für die Lachsterrine brauchte, den ich auch nicht hatte, und als ich nach oben kam, um Catherine zum Konzert abzuholen (Sylvain hatte sich wohlweislich entschuldigen lassen), saß sie erschöpft auf ihrem Bett. Marie sei zu spät gekommen, um sechs hätte alles fertig sein sollen, und nun habe sie nicht einmal mehr Zeit gehabt, sich kurz auszuruhen, sagte sie, und fragte mich, ob die blau gelb gemusterte oder die weiße Tischdecke. Ich optierte für die gemusterte, und wir deckten den Tisch ein. Überhaupt habe Marie sie enttäuscht, die plötzliche Bestimmtheit, mit der sie nach Schnittlauch verlangt habe, und was wisse Marie schon, ihre Gäste würden bestimmt nicht merken, ob sie aus Kristallgläsern oder normalen Gläsern tranken, habe Marie gesagt, aber sie habe ihr nun einmal aufgetragen, die Kristallgläser zu spülen, und dann habe sie das eben zu tun, und das habe sie ihr auch gesagt, sie würde sich nichts mehr gefallen lassen.
Ohne auf die Uhr zu sehen, wanderte Catherine hin und her, holte Teller aus dem Schrank und stellte sie wieder hinein, rückte die Stühle zurecht, bis ich vorschlug, ein Taxi zu rufen, für den Bus war es nun zu spät. Sie wählte den Taxistand an, ließ sich die Adresse zweimal wiederholen, legte mit angespannten Zügen ein Tuch um, und wir gingen auf die Straße hinaus. Kaum saßen wir im Wagen, brauste der Taxifahrer los, Catherines Bitte um langsameres Fahren überhörte er wegen des laufenden Radios, worauf sie ihm in einem Ton, der mich aus dem Fenster sehen ließ, verständlich machte, wir seien nicht auf der Rennbahn und hätten es durchaus nicht eilig, zum Theater zu kommen. Der Taxifahrer grummelte etwas vor sich hin, fast auf seinen Vordermann auffahrend, und nahm einen falschen Weg, darauf machte ich ihn aufmerksam. Catherine sah mit starren Zügen vor sich hin.
Der Abend verlief glimpflich, das Konzert war lang, das Ehepaar, das wir dort trafen, bemüht und versiert in seiner Konversation über Musikstücke und Enkelkinder. Gegen elf kamen wir in Catherines Wohnung zurück, aßen Lachsterrine und Schokoladenkuchen zu einem Glas Champagner. In dem von der Nacht und den ringsum gestapelten Schachteln gedämpften Besteckklirren hangelte Catherine sich von Wort zu Wort.
Als ich sie am nächsten Tag fragte, ob sie etwas vom Markt wolle, hörte ich aus der zögerlichen Antwort, dass der innere Rückzug begonnen hatte. Als Sylvain mit den Einkäufen kam und ich ihr das Obst hochbrachte, zählte sie mir das Geld in die Hand wie einem Handelsvertreter. Den Tee schlug auch ich vor und trug ihn ins Wohnzimmer, wo die Zeitschriften sich türmten, als wüssten sie, dass ihnen bald für eine lange Weile niemand ihr Reich streitig machen würde.
Wir saßen auf dem Sofa, und Panik lag in ihrem Blick. Ihre Teetasse klapperte gegen den Unterteller, ihre Stimme rieb über das englische Porzellan, wenn sie die Tasse gegen den Mund neigte. »Möchten Sie einen Keks?« fragte sie und griff in die Schale. An anderen Tagen hätte sie ihn in den Tee getunkt und dazu verschmitzt gelacht, »das tut man nicht, ich weiß, wir wären dafür früher auf unser Zimmer geschickt worden«. Aber an Tagen wie diesen, auf halbem Weg in die Dämmrigkeit schon tagsüber verdunkelter Räume kam es ihr gar nicht in den Sinn, schon glitt sie nur noch über die Dinge hinweg, rutschte an ihnen ab in die Grundlosigkeit, in eine offenbar von fremden Stimmen widerhallende Erstarrung. Ihr Gesicht war im Begriff, seine Fensterläden zu schließen.
Am nächsten Tag waren ihre Gesichtszüge verzerrt, als liefe ihr Mund ihr fort, in eine andere Region, wo die Artikulation nicht von innen nach außen erfolgt, sondern erstickt die Gurgel hinunter. Nachts hörte ich ihre Schritte über unserem Bett knarren, und noch lange nach Mitternacht fiel der Lichtschein von oben gegen die Mauer des Innenhofs. Morgens blieben die Fensterläden dafür immer länger geschlossen. Verbarrikadierten ein Schlafzimmer mit braunen Stoffwänden, in die wackelige Steckdosen eingelassen waren, gegen den Tag. Erst nach Mittag wurden sie von einem Arm in gestepptem Morgenmantel aufgeschoben, nie ganz, so dass sie den Rest des Tages unschlüssig von der abgeblätterten Mauer wichen. Und keine Musik war mehr zu hören, keine Bach-Messe oder skandinavischen Jazz-Klänge, höchstens einmal Leonard Cohen, in Endlosschleife, und das war eines der schlechtesten Zeichen.
Als wir an einem Freitag, an dem Sylvain mich zu einem Mittagessen in einem der unsäglichen Bistros überredet hatte, die mir immer entbehrlicher wurden, nach Hause kamen, stand ein Feuerwehrwagen auf der Straße, und im Hof hoben sich zwei Feuerwehrmänner rot von den beigen Mauern und dunkelgrünen Fensterläden ab. Im Treppenhaus tastete Catherine sich am Arm ihrer Tochter die Eingangsstufen hinunter. Abwesend nickte sie uns zu wie Fremden, mit leblosem Gesicht und fliehendem Blick. Seither sind die Fensterläden oben ganz geschlossen, und ich stelle mir die dunkle Wohnung vor, still und ausgehöhlt.
Die Amerikanerin aus der zweistöckigen Erdgeschosswohnung kam herauf, um nach Näherem zu fragen. Unter ihrer perfekten Schminke des ehemaligen Models war sie ganz aufgelöst, auf dem Nachhauseweg sei sie einem Selbstmörder begegnet, sie sagte begegnet, und nun das. Einen Plopp habe sie gehört, und sich umgedreht, und da habe er gelegen, halb auf dem Trottoir, halb auf der Busspur, und die Leute seien einfach weitergegangen. Sie habe ihr Taxi natürlich fortgeschickt, und mit einem Motorradfahrer, der ebenfalls angehalten habe, hätten sie über die Wahrscheinlichkeit diskutiert, dass es sich tatsächlich um einen Selbstmörder handelte, keiner von beiden habe den Sturz gesehen, aber die seltsam verdrehte Haltung und der scheußlich zerschmetterte Kopf, und dann sei die Ambulanz gekommen und ein Polizist habe sie befragt, ganz entsetzlich, außerdem sei es der achtzigste Geburtstag ihrer Schwiegermutter, aber sie habe unmöglich zu dem Mittagessen gehen können, und nun Catherine.
Eine Zeit später, die Baumkrone über unserem winzigen Innenhof verlor die ersten Blätter, hörte ich Schritte über dem Esszimmer, und schon riss Catherine oben die Fenster auf und klapperte herumräumend zum Hof hinaus.
Es sei nett in der Klinik, sagte sie mir, als ich zu ihr hinaufging, und mit ihren Zügen entglitt ihr auch immer wieder für Momente die Stimme. Ganz reizend Ärzte und Klinikpersonal, sie habe Bäume vor dem Fenster und würde Gymnastik machen, sogar Tischtennis habe sie gespielt. Man habe ihr den Nachmittag frei gegeben, um Sachen zu holen, noch zwei oder drei Wochen, um die Medikamente abzustimmen, dann würde sie ganz nach Hause kommen. Aber es sei wirklich ein exquisiter Rahmen, und sie habe sich sehr erholt. Eine wunderbare Küche, gesund und leicht, sie habe sich nicht mehr richtig ernährt, das würde sie nun ändern, sie fühle sich sehr gut. Und Schokolade habe sie entdeckt, Schokolade sei gut für die Seele, es gäbe da eine ganz besonders gute von Lindt, ob ich ein Stück wolle? Sie hoffe, dass die Zeichenkurse, für die sie sich im Sommer eingeschrieben habe, nicht schon begonnen hätten, dort müsse sie unbedingt anrufen, außerdem hatte sie in einer Galerie ein Bild zurücklegen lassen, von dort habe man bestimmt schon angefragt, überhaupt würde sie Stunden brauchen, um all die in ihrem Telefon gespeicherten Anrufe zu beantworten, das müsse sie jetzt gleich tun. Ihre Hände zitterten, als sie ihren Blusenkragen zurechtzog. Außerdem müsse sie zum Friseur, aber das könnte sie vielleicht auch in der Klinik, obwohl man nie wisse, sie bestelle sich lieber schon einmal ein Taxi.
Und eine Assoziation würde sie gründen, habe sie beschlossen, einen Verein für Witwen mit Kindern, deren Männer mit dem Auto verunglückt seien, und dann vorgehen gegen solch rabiate Verhaltensweisen wie die jenes Taxifahrers. Empörend rücksichtslos und unverantwortlich seien manche Menschen.
Ich sah sie an. Diese Taxifahrt lag fast zwei Monate zurück. Halsbrecherisch sei das gewesen, fuhr sie fort und legte die ungeöffneten Briefe, die sie vom Küchentisch genommen hatte, wieder dort ab. Eine Missachtung ihres Schmerzes, eines Schmerzes, der in keinem Augenblick der vergangenen dreißig Jahre nachgelassen hatte, der sich in ihr eingenistet hatte, bis sie selbst zur Hülle ihres Schmerzes geworden war, wie ich es mir jetzt dachte, eine dünne, zerbrechliche Hülle, an der jeder kleinste Kratzer eine dunkel darunter brodelnde Lava hervorquellen ließ. Zähe Ströme Bitterkeit, die sich über uns durch die Wohnung wälzen, durch die jetzt wieder leere Wohnung hinter den weißen Fensterläden, direkt über meinem Kopf, über der Zimmerdecke, die bei jedem Schritt oben bebt. Feine Risse ziehen sich dort, ich sehe sie, wenn ich im Bett liege und nach oben schaue, und heute Nacht war mir, als hätten sich in dem größten Riss, dort, wo die weiße Farbe schon leicht aufgesprungen ist, kleine dunkle Tropfen gebildet.
Related Projects
Am Ende Nathalie
Am Ende NathalieAm Ende NathalieEine kleine Geschichte aus Paris, Teil eines Romans, dessen...
A House with Cherry Trees
A House with Cherry TreesThe car was parked at a fork in the road. The windows were rolled down,...
Der Kleiderbaum
Der KleiderbaumAn einer Weggabelung stand der Wagen. Die Fenster waren heruntergekurbelt, feuchte...
Das Haus und die Insel
Das Haus und die InselSie sperrten die Hunde in die Garage. Das Mädchen stellte ihnen einen Napf...
Jockey
JockeyIch bin wegen der Pferderennen nach Paris gekommen. Wie auch immer das auf Französisch...
Hier ein Meer, dort eine Fabrik
Hier ein Meer, dort eine FabrikHier ein Meer, dort eine Fabrik Momar rief aus Marrakesch an, als...