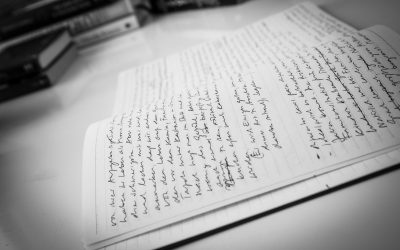Hier ein Meer, dort eine Fabrik
Hier ein Meer, dort eine Fabrik
Momar rief aus Marrakesch an, als ich mir gerade einen Salat zum Mittagessen mache, deprimiert vom Stand der katalanischen Politik, fahrig vom Wind, der gegen die Fenster toste, als wollte ein Gott die Welt seinen Zorn spüren lassen.
„Du bist also los“, sagte ich, und er antwortete, „Ja, ich bin los, aber nicht auf der Route, von der wir gesprochen haben“.
Zuletzt hatte er aus Dakar angerufen, und ich hatte ihn an die Gefahren erinnert, die ihm auf einer Fahrt durch die Wüste drohen würden, an die Schieber, Banditen, Unfälle, an all das, was man über die Verzweiflung der Menschen las, die sich auf diesen Weg begeben. An die Boote, die Skrupellosigkeit, an all das Unvorstellbare.
Er hatte das Geld zusammengekratzt und hatte sich aufgemacht. Er hatte ein Flugzeug bis in den Norden Senegals genommen und von dort einen Bus bis nach Marrakesch. Am Telefon zusammengefasst in einer halben Minute, während ich in Barcelona eine Avocado schnitt.
Er warte auf Nachrichten von einer Frau, „une dame“ sagte er, die ihm bezüglich der möglichen Überfahrten Bescheid geben solle. In der Zwischenzeit werde er für einen Tag nach Agadir fahren, um sich dort umzusehen.
Von Agadir fahren die Boote ab, die die Kanarischen Inseln ansteuern. Ich telefoniere mit jemandem, der womöglich ein paar Tage später auf einem wackeligen Kahn über das Meer kreuzen würde. Es war November. Wie hatte er das Geld zusammenbekommen? Sein letzter Alternativplan war ein Flug nach Malaysia gewesen, wo offenbar Arbeitskräfte gebraucht wurden. Ein Ticket von Dakar nach Kuala Lumpur kostete an die fünftausend Euro.
Als ich Momar kennenlernte, lebte er in einer besetzten Fabrik in der Nähe des unübersichtlichsten Flohmarkts der Welt, der Encants, auf dem man von Medaillen aus dem Zweiten Weltkrieg über Spiderman-Figuren bis zu Lötkolben alles bekommen konnte. Inzwischen wurde den anarchischen Zuständen dieses Labyrinths aus Verkaufstischen ein Ende gemacht und auf der anderen Seite des vierspurigen Kreisverkehrs von Glories ein neues, nicht minder scheußliches Konstrukt errichtet, auf mehreren Ebenen mitsamt Überdachung.
Um die Ecke des alten Geländes aber lag die Fabrik, ebenso unüberschaubar und verschachtelt, in die Jordi und ich vom Bürgerzentrum Poblenou geschickt worden waren, um mit Fragebögen eine Erhebung über die Bewohner zu erstellen und zu erfragen, wer an möglichen Weiterbildungen oder Sprachkursen interessiert sei.
Ich war in Barcelona angekommen, wie man als Europäer eben ankommt. Ich hatte mir eine Wohnung genommen, meinen Computer auf einen Schreibtisch gestellt und weitergearbeitet. Ich hatte ein Kind bekommen, ging mit ihm zum Strand, dem großen Spielplatz der Stadt, und flog in den Ferien quer durch die Weltgeschichte.
Damit war ich nicht allein. Barcelona ist in den letzten Jahren zu einer der Hauptattraktionen der globalisierten Reisebegeisterung geworden. Als ich ankam, gab es noch eine Wintersaison, in der die Strände leer waren und die Bewohner der Barceloneta sonntags ihren Wermut in alten Bars mit Blick auf den Strand tranken. Inzwischen reihen sich dort Surfläden und coole Lokale, in denen man frisch gepresste Säfte, vegane Hamburger und Quinoa-Salate bekommt. Wenn man sich erst einmal den Weg bis hierher am Hafen entlang erkämpft hat, vorbei am Emporium der Nike-Turnschuhe, Gucci-Taschen und Sonnenbrillen, alles fake natürlich, aber wen stört das, die chinesische Wirtschaft boomt. Die Waren sind auf Tüchern ausgebreitet, die im Notfall schnell an den vier Enden zusammengerafft und als Bündel auf den Rücken gehievt werden können. Bis die neue Bürgermeisterin die Spielregeln änderte, wurden die Verkäufer in regelmäßigen Abständen von motorisierten Polizisten verscheucht. Man sah sie in großen Gruppen an
den Luxusyachten des neu veredelten Yachthafens vorbeihasten, sich durch den fahrenden Verkehr schlängeln, ihre Schritte hallten durch die schmalen Gassen. Allein die Metro-Stationen waren neutrales Gebiet, dort konnte ihnen niemand etwas anhaben. Wie beim Fangenspielen, der Ort, an dem man freischlägt. In langen Reihen sah man sie dort auf den Bänken sitzen, ihre Bündel vor sich zwischen den Beinen. Sie unterhielten sich, lachten, den Blick nach vorne gewandt. Manchmal kam eine Frau mit einem Einkaufswagen vorbei, in dem sie Essen hatte, das sie an die Jungs verkaufte. Sollte ich hinzufügen, dass sie ebenfalls Schwarzafrikanerin war, um einen möglichst neutralen Begriff zu benutzen? Spielt ihre Hautfarbe eine Rolle? Wenn ich als weiße Europäerin sie beschreibe? Dass jemand weiß ist, würde ich explizit wahrscheinlich nur in einem außereuropäischen Kontext erwähnen. Verliert oder gewinnt diese Frau etwas von ihrer Identität, wenn ich ihre Hautfarbe nicht benenne?
Eine Zeitlang gab ich Alphabetisierungskurse im Bürgerzentrum vom Poblenou. Jeden Dienstagnachmittag stand ich vor acht Marokkanerinnen, einer Senegalesin, zwei Pakistanern und zwei Nigerianern und sah meine Unfähigkeit, mein Leben zu begreifen, in ihnen gespiegelt, meine Sinnsuche. Ich kam mir vor wie eine Hochstaplerin und leistete dafür Abbitte, indem ich diese Farce des Unterrichtens fortführte, mich selbst beobachtete, wie ich mir Wörter für Buchstaben ausdachte, die irgendwann einmal jemand erfunden oder von einem anderen übernommen hatte, um die Laute, die Menschen von sich gaben, zu reglementieren, und die allgemein von der jeweiligen Sprachgemeinde als etwas Gottgegebenes betrachtet wurden, das zu erlernen unablässiger Schlüssel für das Reich der Auserwählten war.
Die zunehmend ungezwungene Fröhlichkeit der Frauen half mir, mich zu entspannen. Sie kicherten hinter hochgezogenen Kopftuchzipfeln, warfen sich arabische Wortfetzen durch das Klassenzimmer zu, die von den weniger schüchternen für mich ins Spanische übersetzt wurden, und ignorierten majestätisch die paar männlichen Exemplare, die sich in die Stunde verirrt hatten. Der schmale Raum mit den Bildern und Buchstaben an den Wänden war ihre kleine Auszeit, aus der sie fünf Minuten vor Unterrichtsschluss
forteilten, um die Kinder von der Schule abzuholen. Ich lernte ihre Namen, seit wann sie in Barcelona waren, fragte mich, wie sie all die Jahre zurechtgekommen waren, ohne ein Straßenschild lesen zu können, und dann nutzte ich die Zwangspause der Sommerferien, um mich von meinem Posten zu verabschieden. Wie oft hatte ich mich schon aus meinem eigenen Leben fortgestohlen, hatte Uni, Stadt, Land gewechselt. Weil die Ideen immer so viel weiter tragen als die Wirklichkeit.
Jetzt ging ich einmal wöchentlich zu der Arbeitsgruppe, die Fortbildungskurse für Migranten organisieren sollte. Viele von ihnen, vor allem Afrikaner, lebten in den besetzten Fabriken und Lagerhallen im Poblenou, dem ehemaligen Industrieviertel von Barcelona. Eine Initiative der evangelischen Kirche hatte in einem strengen Winter, als die Krise über alle hergefallen war, begonnen, ihnen Lebensmittel zu bringen. Zweimal wöchentlich fuhren jeweils zwei Freiwillige die verschiedenen Adressen ab, die im Laufe der Zeit auf die Liste gekommen waren, um entsprechend der Anzahl der Bewohner Reis, Nudeln, Öl und Dosentomaten zu verteilen. Das war natürlich nur eine Notlösung, die auf Dauer keinem half; deshalb war man im Bürgerzentrum auf die Idee eines Nachbarschaftsnetzwerks für kleine Reparaturen gekommen.
Ferrán und ich waren die Fabriken abgefahren, um Fragebögen auszufüllen und Kandidaten für den Kurs zu rekrutieren, dessen Teilnehmer lernen sollten, wie man Haushaltsgeräte repariert. Eine Hilfsorganisation stellte dafür ihren Lagerraum zur Verfügung, in den ((wh.)) deckenhohen Regalen stapelten sich Kartons mit sortierter Kleidung. Dort standen die zehn jungen Männer an einem langen Tisch und lernten, wie man Steckdosen auseinandernimmt und wieder zusammenbaut und was es mit dem Innenleben eines Toasters auf sich hat. Unterwiesen wurden sie von Adolf, einem Mittfünfziger mit Rauschebart, der kein Handy besaß und wirkte, als wäre er gerade mit dem Mountainbike aus den Pyrenäen gekommen. Dann nahte wieder der Sommer, und an besonders schönen Tagen fanden sich gerade noch drei Teilnehmer zum Herumschrauben ein. Der Hafen rief, die Touristen flanierten, die Eltern, Geschwister, Tanten, Onkel warteten auf Nachricht von Western Union.
In den letzten beiden Jahren hat sich die Situation für die Straßenverkäufer dank der neuen Bürgermeisterin, die früher einmal Hausbesetzerin war, deutlich verbessert. Am Hafen kommt man kaum noch zwischen den Waren hindurch, die über fast einen Kilometer links und rechts von einer schmalen Trasse ausgebreitet sind, an manchen Stellen läuft man Gefahr, von einem Kinderwagen, einem Fahrrad oder einer Gruppe motorisierter Roller auf eine liebevoll arrangierte Auslage von Fußballtrikots oder großflächig ausgebreiteter indischer Tagesdecken gedrängt zu werden.
Momar hatte davon gehört, wie erfolgreich der Straßenverkauf in der Stadt wieder ist, die „Top Mantas“ wie sie hier genannt werden, kommen inzwischen von überall her, sogar aus Italien. Es ließ ihm keine Ruhe, er hatte alles versucht, um auf legalem Weg nach Europa zurückzugelangen. Das erste Mal war so einfach gewesen, ein Freund, der ihm ähnlich sah, zumindest einigermaßen, hatte ihm seinen Pass mit einem gültigen Visum darin gegeben, er hatte in Dakar ein Flugzeug genommen und war in Barcelona ausgestiegen, hatte ein paar Tage bei seiner Schwester gewohnt, die mit ihrem Mann und ihrer Tochter in einem Vorort lebt, und sich dann selbstständig gemacht, voller Tatendrang.
Er zog in die Fabrik, besorgte sich mit Nonchalance seinen ersten Stock Ware für den Hafen, alles lief nach Plan, sagte er, dann wurden ihm die Sonnenbrillen konfisziert und er musste von vorne anfangen. Das Bürgerzentrum von Poblenou vermittelte ihm eine Ausbildungsstelle als Kellner. Vier Monate mit praktischem Einsatz in einem solidarischen Café. Momar war voller Elan. Als die vier Monate vorbei waren, bekam er keinen Job. Er ließ sich die Rastas abschneiden, aber das war es auch nicht, es waren die Papiere. Im Bürgerzentrum fing er an, Katalanisch zu lernen. Das Spanische war ihm praktisch zugeflogen, auf dem Arbeitsmarkt hätte er mehr Chancen mit Katalanisch, sagte man ihm. Hätte er Papiere.
Kam man in die Fabrik, von dem schmalen Gehsteig durch die überraschend kleine Metalltür mit dem zersprungenen Riffelglas, war erst einmal alles dunkel, bis sich die Augen langsam daran gewöhnten, in dem trüben Zwielicht Umrisse auszumachen. Treppenstufen mit dem melierten Muster einer über Jahrzehnte festgetretenen Schmutzschicht, ein Autowrack, eine mit Planen verhängte Sperrholzwand. Hinter einer schwarz spiegelnden Wasserlache öffnete sich eine Halle, die durch die hohen Dachfenster über den Metallstreben geradezu hell wirkte. Nur wenige Lichtpartikel erreichten tatsächlich den Boden, so dass die Gesichter derer, mit denen man sich hier unterhielt, immer etwas Vages behielten.
Die Holzwand umgab den Aufenthaltsraum, bestehend aus einem mottenzerfressenen Sofa und einem Tisch mit zwei Stühlen, und wer immer etwas richten, schrauben oder hämmern musste, kam hierher, wo Strom und Neonlicht am solidesten waren. Abends gegen zehn wurde alles beiseitegeschoben und ein Fitnessraum eingerichtet, erklärte man Ferrán und mir, in dem die Jungs Sit-ups machten und trainierten, mit Hanteln, einem Rudergerät, an Stangen.
Durch eine Tür in der Sperrholzwand betraten wir Momars Zimmer, da stand ein Bett mit bunter Überdecke, ein Tischchen mit einem Fernseher, in dem Musikvideos liefen, eine Stehlampe erleuchtete alles, die Wände waren mit einer Blümchentapete tapeziert. Erst später fragte ich mich, woher der Strom kam. Auf einer Kochplatte stand eine silberne Teekanne. Nachdem das Wasser mit dem grünen Tee eine Weile gekocht hatte, maß Momar Zucker mit einem Teeglas ab und rieselte ihn hinein. In hohem Bogen goss er den Tee in eines der beiden verzierten Gläser. Von dem einen Glas in hohem Bogen ins andere. Dann wieder zurück in die Kanne. Von der Kanne wieder in das eine Glas, von dort ins andere, ein kleiner Rest in einen großen Blechtopf, der zu diesem Zweck auf dem Boden stand. Zahllose Male wiederholte er das Zeremoniell, bis der Tee schäumte. Er reichte jedem von uns ein Glas, der Tee legte sich heiß und bittersüß auf meine Zunge.
„Warum machst du das?“, fragte er mich einmal.
„Was?“, fragte ich zurück.
„Hierherkommen und all das“, sagte er. Irgendwann hatte ich seine Einladung ausgeschlagen, zu zweit auszugehen, offenbar war ich ihm ein Rätsel. Ich wusste nicht, was ich antworten sollte. Wie sollte man erklären, was man für sich selbst nicht in Worte fassen wollte. Das Privilegiertsein. Dass einem all diese Dinge nicht zustoßen konnten, mit denen Momar und die anderen sich tagtäglich herumschlagen mussten. Dass ich mir vermutlich nie in einer leer stehenden Fabrik ein Kabuff bauen würde.
Irgendwann verlor Momar den Glauben an Spanien. Er fuhr nach Frankreich, wo es auch keine Arbeit gab, dann nach Belgien, um Asyl zu beantragen, monatelang bei Minusgraden in einem Aufnahmelager bei Lüttich, wieder zurück nach Frankreich. Dort heiratete er eine sehbehinderte Französin, der er in Barcelona einmal aus der Patsche geholfen hatte und um die er sich mit aufrichtiger Zuneigung kümmerte. Nach der Hochzeit hatte er mich angerufen, das Telefon an seine Frau Nadine weitergegeben, deren Stimme unsicher klang, aber auf den Fotos hatten sie glücklich gewirkt.
Momar wollte eine Familie gründen, er war jetzt dreißig. Doch Nadines Eltern gerieten in Panik, als sie schwanger wurde, woraufhin sie die gemeinsame Wohnung verließ, Momar der Vergewaltigung beschuldigte und abtrieb. Ein paar Wochen später wurde er, immer noch in der einst gemeinsamen Wohnung, festgenommen und nach Dakar zwangsrepatriiert. Seine Bemühungen, über einen Anwalt bei der französischen Botschaft ein Visum zu erlangen, um bei dem Scheidungsverfahren anwesend sein zu können, waren erfolglos, ebenso seine Versuche, einen Teil der auf dem gemeinsamen Konto deponierten Hochzeitszuwendungen für sich zu beanspruchen.
Seitdem versucht Momar, wieder nach Europa zu kommen.
„Kannst du nicht Arbeit in Dakar finden?“, fragte ich ihn, ich stellte mir das Leben für ihn dort so viel besser vor. Er war gelernter Schweißer, aber auf dem Bau sei es aussichtslos, sagte er, die französischen Baufirmen importierten chinesische Arbeiter. „Hier gibt es nichts für uns.“
Ich vermittelte ihm den Kontakt zu einem in Barcelona ansässigen Senegalesen, der in ein Taxi in Dakar investieren wollte, eine rentable Anschaffung, wie er sagte. Momar kaufte das Auto, schickte mir ein Foto, posierte stolz mit dem dunkelblauen Peugeot aus zweiter Hand. Zwei Wochen später wartete er nach einem Fußballspiel bei strömendem Regen auf Passagiere, ein Lastwagen verlor in einer Kurve die Kontrolle und rutschte in seinen Wagen. Momar brach sich ein Bein, das Auto war nicht mehr zu gebrauchen. Als das Bein geheilt war, heuerte ihn ein Verwandter für seine Hühnerfarm außerhalb der Stadt an. Nach einem Monat erklärte er ihm, er könne ihn für’s Erste nicht bezahlen, stattdessen schlug er ihm Prozente an den Eierverkäufen vor. Momar rechnete aus, dass er sich mit dem Wochenlohn bei guten Verkäufen gerade mal ein Taxi nach Dakar leisten konnte, und verabschiedete sich.
Dann kamen der Malaysia-Plan und die Reise nach Marokko. Dort blieb er zunächst in einem Call Center hängen, er bat mich um einen kleinen Zuschuss für die Arbeitserlaubnis, ich hoffte, es könnte ihm gefallen. Ich hoffte, er würde nicht sein gesamtes Geld einem der Mittelsmänner übergeben, der ihn mit etlichen anderen in einem stickigen Lieferwagen an die Küste fahren würde, wo er in einem Versteck tage- oder wochenlang darauf warten müsste, abgeholt zu werden, von den Mittelsmännern in unregelmäßigen Abständen mit Wasser und ein wenig hartem Brot versorgt. Dass er nicht mit Knüppeln in ein Boot getrieben würde, das er selbst zusammengezimmert hatte und das unter dem Gewicht seiner Insassen bereits am Ufer so tief lag, dass das Wasser auch ohne Seegang hineinschwappte. Dass er nicht von einem orientierungslosen Kapitän durch schwarze Wellentäler gelenkt würde, mit einer Schale das Wasser aus dem Rumpf schöpfend. Dass Motor und Benzin keine Explosion verursachen würden, einer plötzlich lichterloh in Flammen stände und ins Meer spränge, um sie zu löschen, gleich verschluckt von Wasser und Nacht. Dass er nicht einer derer wäre, die vor Kälte und Hunger in sich zusammensackten und nicht mehr aufwachten, die Küste nicht mehr erblickten, die sich nach zwei endlosen Tagen und Nächten am Horizont abzeichnete, verheißungsvoll näherkam, dass er nicht vor Euphorie ins Wasser spränge, wo es noch einen halben Meter zu tief war, dass er nicht kurz vor der Küste ertrinken würde, dass die Guardia Civil ihn in
Empfang nehmen, mit Decken und Wasser und Essen versorgen würde, dass sie ihn nicht zurückschicken, sondern von den Kanarischen Inseln aufs spanische Festland übersenden würden, damit wenigstens nicht alles umsonst gewesen wäre und er die Reise nicht noch einmal unternehmen müsste.
In der Fabrik gab es irgendwann einen kleinen Schwelbrand, die Behörden nahmen es als Vorwand, sie zu räumen. Mit vermauertem Eingang steht sie jetzt da, an den Balkonen gegenüber wehen die katalanischen Unabhängigkeitsflaggen, seit Monaten spricht man hier von nichts anderem mehr.
Related Projects
Am Ende Nathalie
Am Ende NathalieAm Ende NathalieEine kleine Geschichte aus Paris, Teil eines Romans, dessen...
A House with Cherry Trees
A House with Cherry TreesThe car was parked at a fork in the road. The windows were rolled down,...
Der Kleiderbaum
Der KleiderbaumAn einer Weggabelung stand der Wagen. Die Fenster waren heruntergekurbelt, feuchte...
Comtesse de Sévigné auf Abwegen
Comtesse de Sévigné auf AbwegenÜber unserem Wohnzimmer, dem ausufernden Bücherregal, stand ein...
Das Haus und die Insel
Das Haus und die InselSie sperrten die Hunde in die Garage. Das Mädchen stellte ihnen einen Napf...
Jockey
JockeyIch bin wegen der Pferderennen nach Paris gekommen. Wie auch immer das auf Französisch...